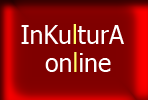Buchkritik -- Norbert Bolz -- Zurück zur Normalität
 Norbert Bolz’ „Zurück zur Normalität“ ist weit mehr als ein kulturpolitischer Appell, es ist ein leidenschaftliches Plädoyer für die Wiederherstellung eines verloren gegangenen Gleichgewichts inmitten der in Aufruhr geratenen Debatten unserer Zeit. Bolz schöpft aus einem reichhaltigen Fundus philosophischer, soziologischer und medientheoretischer Reflexionen, um die verschiedenen Facetten des „Normalen“ gegen jenen moralischen und medialen Furor in Stellung zu bringen, der uns zu überwältigen droht.
Norbert Bolz’ „Zurück zur Normalität“ ist weit mehr als ein kulturpolitischer Appell, es ist ein leidenschaftliches Plädoyer für die Wiederherstellung eines verloren gegangenen Gleichgewichts inmitten der in Aufruhr geratenen Debatten unserer Zeit. Bolz schöpft aus einem reichhaltigen Fundus philosophischer, soziologischer und medientheoretischer Reflexionen, um die verschiedenen Facetten des „Normalen“ gegen jenen moralischen und medialen Furor in Stellung zu bringen, der uns zu überwältigen droht.
Zu Beginn skizziert der Autor präzise, wie „Wokeness“ als gegenkulturelle Bewegung ihre Ursprünge in einer emanzipatorischen Kritik fand, heute jedoch in eine übersteigerte Selbstbeobachtung mündet: Ein jeder Makel der Vergangenheit wird akribisch seziert, während das Heute im Verdacht steht, strukturell unmoralisch zu sein. Bolz schildert eindringlich, wie aus der guten Absicht, Ungerechtigkeit aufzudecken, eine allumfassende Empfindsamkeit entsteht, die längst nicht mehr zwischen handfesten Vergehen und bloßer Differenzierung unterscheidet. In pointierten Kapiteln legt er dar, dass jene Instanz, die einst als kritisches Korrektiv fungierte, inzwischen selbst zum moralischen Totengräber des Gewöhnlichen avanciert.
Parallel dazu führt Bolz die Leserinnen und Leser durch die Mechanismen des Alarmismus, der sich in Schlagzeilen und Live-Tickern manifestiert. Er analysiert die Dynamik, in der eine Nachrichtenskala vom vermeintlichen Weltuntergang bis zum kleinen Furunkel der Fehlmeldung nur noch durch einen Mausklick getrennt ist. In seinen Exkursen vergleicht er den heutigen Dauer-Notfallmodus mit dem barocken Drang zur Katastrophe und zeigt, wie diese Panikspirale nicht nur den öffentlichen Diskurs lähmt, sondern die individuelle Urteilsbildung erstickt.
Ein Herzstück seines Werkes ist die Rekonstruktion einer Begriffsgeschichte von Normalität als einer zivilisatorischen Errungenschaft: Bolz bezeichnet sie als das unsichtbare Fundament, auf dem alle sozialen Interaktionen ruhen. Anhand historischer Beispiele, von der Alltagsroutine in der Frühen Neuzeit bis zu den kontemplativen Pausen in der Industriegesellschaft, demonstriert er, wie selbst kleinste Gewohnheiten eine enorme Widerstandskraft entfalten können. Dieser Teil des Buches liest sich wie eine kulturhistorische Wanderung durch die Sitten und Gebräuche, die wir oft erst dann wertschätzen, wenn sie brüchig werden.
Weiterhin legt Bolz ein ebenso scharf konturiertes wie liebevolles Plädoyer für den Konservativismus vor, den er nicht als rückwärtsgewandte Ideologie, sondern als „Glaube an die Normalität“ versteht. Er entwirft ein Bild des konservativen Denkens, das weder Fortschritt verteufelt noch das Bewährte glorifiziert, sondern beides in eine produktive Spannung bringt.
Norbert Bolz nähert sich dem Konzept der „Selbstentfremdung“ nicht als ein rein negatives Phänomen, das überwunden werden muss, sondern vielmehr als eine inhärente Bedingung der modernen Existenz, die ein „souveräner Bürger“ anerkennen und sogar annehmen sollte. Seiner Ansicht nach entsteht das Gefühl der Entfremdung aus der Tatsache, dass die zeitgenössischen Lebensbedingungen und gesellschaftlichen Strukturen nicht mehr mit traditionellen menschlichen Maßstäben messbar sind. Dies ist größtenteils auf den allgegenwärtigen Einfluss der Technologie und das komplexe, oft undurchsichtige Funktionieren sozialer Systeme zurückzuführen.
Bolz schlägt vor, dass Individuen, anstatt dieser Entfremdung zu widerstehen, lernen sollten, sie zu bejahen. Dies beinhaltet die Aufrechterhaltung einer gewissen emotionalen Distanz und das Aufgeben des Bedürfnisses nach einem festen, allumfassenden Weltbild. Dadurch können Individuen eine Form der Freiheit erreichen, die genau aus diesem Zustand der Loslösung entsteht. Diese Perspektive stimmt mit Arnold Gehlens berühmter Formel „Die Geburt der Freiheit aus der Entfremdung“ überein, die besagt, dass menschliche Freiheit aus den Bedingungen der Entfremdung und Institutionalisierung selbst entstehen kann.
Im Kontext von „Zurück zur Normalität“ dient Bolz‘ Diskussion der Selbstentfremdung dazu, zeitgenössische Bemühungen zu kritisieren, diese inhärente Bedingung durch das, was er als künstliche oder ideologische Mittel wahrnehmen könnte, zu beseitigen oder zu leugnen. Er stellt klar, dass Versuche, eine Rückkehr zu einem vor-entfremdeten Zustand zu erzwingen, vergeblich und potenziell schädlich sind und eher zu einer Form von „sanftem Wahnsinn“ als zu echtem Wohlbefinden führen. Stattdessen plädiert er für eine pragmatische Akzeptanz der Entfremdung als Voraussetzung, um die Komplexität des modernen Lebens mit einem klaren und rationalen Verstand zu navigieren. Diese Akzeptanz ist für Bolz ein Schlüsselbestandteil der Rückkehr zu einem Zustand der „Normalität“, einem Zustand, der durch ein realistisches Verständnis menschlicher Grenzen und gesellschaftlicher Realitäten gekennzeichnet ist.
Bolz’ Lesart des Kapitalismus gleicht einem feuilletonistischen Streifzug durch die Konsumlandschaften einer spätmodernen Kulturreligion. Konsum erscheint nicht mehr als bloßes Mittel zum Zweck, sondern als symbolische Sehnsucht nach Identität und Gemeinschaft. Die Warenbeziehungen ersetzen metaphysische Sinnangebote und prägen eine Form kollektiver Befriedung, in der das permanente Verlangen selbst zum Motor geschichtlicher Neuerungen wird. Der Kapitalismus wird dadurch nicht nur als rational-effizientes Wirtschaftsmodell gefeiert, sondern als anthropologisches Ordnungsgefüge, das mithilfe ökonomischer Dynamiken psychische Stabilität stiftet und Konflikte abfedert.
Auch die Wissenschaft steht in Bolz’ Entwurf nicht außerhalb dieses Prozesses, sondern fungiert als zentraler Mechanismus der Entfremdung. Sie versetzt uns in ein Feld der Hypothesen und Modelle, in dem die Welt als abstraktes System begreifbar wird und persönliche Subjektivität zurücktritt. Doch warnt der Autor zugleich vor der Verehrung eines monolithischen Expertenglaubens, dem er eine kulturpessimistische Sprengkraft zuschreibt: Wo Wissenschaft nicht mehr als offener Wettbewerb von Ideen, sondern als Autoritätsanspruch betrieben wird, droht Hysterie statt Erkenntnisgewinn. Erst in der Anerkennung ihrer prinzipiellen Vorläufigkeit entfaltet die Wissenschaft ihre emanzipatorische Kraft.
Mit messerscharfer Logik und eindringlicher Diktion gelingt es Bolz, selbst komplexe Theorien in eine narrative Form zu übersetzen, die sowohl den Intellekt anspricht, als auch das ästhetische Vergnügen nicht vermissen lässt. Das Buch ist gespickt mit ironischen Bonmots und mit analytischen Passagen, die jede Übertreibung vermeiden. Am Ende steht nicht nur der Appell, sondern das Versprechen: Normalität ist keine statische Größe, sondern ein dynamisches Gefüge, das wir aktiv erhalten müssen.
„Zurück zur Normalität“ ist somit ein Lesevergnügen ersten Ranges: Ein Werk von großer Aktualität, das jene ermutigt, die sich nach einer neuen Gelassenheit sehnen, und jene herausfordert, die zur Dauerempörung angetrieben werden. Bolz lädt seine Leserinnen und Leser dazu ein, das Alltägliche wieder als Bühne der Freiheit zu entdecken und sie erahnen zu lassen, dass gerade in der Wiederkehr des Gewöhnlichen ein kraftvoller Aufbruch liegen kann. Eine Lektüre, die überzeugt, erhebt und tröstet, absolut empfehlenswert für alle, die in Zeiten des Lärms das leise Flüstern der Normalität wieder hören möchten.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 7. Juli 2025