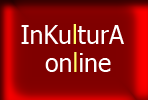Buchkritik -- Martin Mosebach -- Die Richtige
 Martin Mosebach, ein Schriftsteller von unbestreitbarer literarischer Eigenart und intellektueller Schärfe, präsentiert mit seinem Roman „Die Richtige“ ein Werk, das sich auf vielschichtige Weise mit den Abgründen menschlicher Beziehungen, der Ambivalenz von Kunst und Leben sowie den Verflechtungen von Liebe und Macht auseinandersetzt. Mosebach, bekannt für seine stilistische Brillanz und seinen oft humorvoll-zynischen Blick auf die Gesellschaft, liefert hier ein komplexes Psychogramm, das den Leser in eine Welt entführt, in der die Grenzen zwischen Realität und künstlerischer Inszenierung verschwimmen. Der Roman, der sich um die Figur des Aktmalers Louis Creutz rankt, bietet eine faszinierende, wenn auch bisweilen verstörende Auseinandersetzung mit der Künstlerpersönlichkeit und ihrem Einfluss auf die Umgebung. Mosebachs Prosa ist dabei so dicht und vielschichtig, dass sie eine intensive Lektüre erfordert und den Leser immer wieder dazu anregt, über die vermeintlichen Wahrheiten der Erzählung hinauszublicken. Es ist ein Roman, der provoziert, Fragen aufwirft und lange nach der Lektüre im Gedächtnis bleibt, nicht zuletzt aufgrund seiner unkonventionellen Erzählweise und der tiefgründigen Charakterstudien.
Martin Mosebach, ein Schriftsteller von unbestreitbarer literarischer Eigenart und intellektueller Schärfe, präsentiert mit seinem Roman „Die Richtige“ ein Werk, das sich auf vielschichtige Weise mit den Abgründen menschlicher Beziehungen, der Ambivalenz von Kunst und Leben sowie den Verflechtungen von Liebe und Macht auseinandersetzt. Mosebach, bekannt für seine stilistische Brillanz und seinen oft humorvoll-zynischen Blick auf die Gesellschaft, liefert hier ein komplexes Psychogramm, das den Leser in eine Welt entführt, in der die Grenzen zwischen Realität und künstlerischer Inszenierung verschwimmen. Der Roman, der sich um die Figur des Aktmalers Louis Creutz rankt, bietet eine faszinierende, wenn auch bisweilen verstörende Auseinandersetzung mit der Künstlerpersönlichkeit und ihrem Einfluss auf die Umgebung. Mosebachs Prosa ist dabei so dicht und vielschichtig, dass sie eine intensive Lektüre erfordert und den Leser immer wieder dazu anregt, über die vermeintlichen Wahrheiten der Erzählung hinauszublicken. Es ist ein Roman, der provoziert, Fragen aufwirft und lange nach der Lektüre im Gedächtnis bleibt, nicht zuletzt aufgrund seiner unkonventionellen Erzählweise und der tiefgründigen Charakterstudien.
Im Zentrum von Mosebachs „Die Richtige“ steht Louis Creutz, ein Aktmaler in seinen Fünfzigern, dessen künstlerisches Credo die akribische Darstellung der menschlichen Haut, des „Inkarnats“, ist. Creutz’ Auffassung von Kunst ist radikal: Für ihn zählt allein das Bild, nicht das Modell. Er strebt danach, eine Realität zu schaffen, die die des realen Modells übertrifft, eine „Täuschung“, die zur eigentlichen „Wirklichkeit“ wird. Diese künstlerische Obsession ist nicht nur ein ästhetisches Prinzip, sondern durchdringt auch Creutz’ Interaktionen mit seinen Mitmenschen. Er behandelt sie als Objekte, als Material für seine Kunst, was eine zynische Distanz und eine manipulative Grundhaltung offenbart.
Die eigentliche Handlung des Romans entfaltet sich um die arrangierte Ehe von Dietrich, dem widerspenstigen Schwager von Creutz’ Mäzenin Beate, mit Astrid, einer talentierten Sängerin. Creutz wird in diese familiäre Angelegenheit hineingezogen, um als psychologischer Mittler zu fungieren. Doch seine Rolle geht weit über die eines Vermittlers hinaus. Er wird zum Beobachter, zum Manipulator, der die Beziehungen der anderen Figuren nach seinen eigenen ästhetischen und psychologischen Vorstellungen formt. Das sich anbahnende Verhältnis zwischen Louis und Astrid ist dabei weniger eine romantische Verwicklung als vielmehr ein Experiment Creutz’, die Dynamik menschlicher Beziehungen zu sezieren und zu kontrollieren.
Astrid, die „Richtige“ im Titel, ist eine faszinierende Figur. Ihre gescheiterte Gesangskarriere hat sie nicht gebrochen, sondern ihr eine innere Stärke verliehen, die Louis’ Interesse weckt. Ihre Fähigkeit, mit ihrem Gesang zu bezaubern, selbst wenn dieser von Enttäuschung und Kampf zeugt, macht sie zu einem idealen „Modell“ für Creutz’ künstlerische und psychologische Studien. Mosebach beschreibt sie in einem eindringlichen Bild als „Statue aus Bronze, in ihrem Innern mit Glut gefüllt“, was ihre scheinbare Unnahbarkeit und gleichzeitig ihre innere Leidenschaft verdeutlicht. Sie ist nicht nur ein passives Objekt, sondern eine Figur, die durch ihre Präsenz und ihr Talent die starren Strukturen, die Creutz um sich herum aufbaut, herausfordert.
Die Nebenfiguren, wie der Kunsthistoriker Rucktäschel und die Landstreicherin Flora, wirken zunächst wie lose Episoden, die die Haupthandlung unterbrechen. Doch sie dienen dazu, das Panorama von Creutz’ Welt zu erweitern und seine philosophischen und künstlerischen Ansichten zu spiegeln oder zu kontrastieren. Rucktäschel repräsentiert die akademische, oft sterile Auseinandersetzung mit Kunst, während Flora eine rohe, ungeschliffene Existenz verkörpert, die außerhalb der bürgerlichen Konventionen steht. Diese scheinbar disparaten Elemente fügen sich zu einem Gesamtbild zusammen, das die Vielschichtigkeit von Mosebachs Erzählabsicht unterstreicht.
Die Beschreibungen von Louis’ Atelier und Picassos Atelier, in denen Tauben eine symbolische Rolle spielen, rahmen die Handlung und verleihen ihr eine metaphysische Dimension. Die Tauben, oft als Symbol des Heiligen Geistes interpretiert, könnten hier auf die spirituelle oder transzendente Ebene der Kunst verweisen, die Creutz in seiner obsessiven Suche nach der „Wirklichkeit“ im Bild zu erreichen versucht. Gleichzeitig können sie auch die Verletzlichkeit und die Gefangenschaft der Figuren in Creutz’ künstlerischem Kosmos symbolisieren. Mosebach gelingt es, durch diese subtilen Details eine Atmosphäre zu schaffen, die über die reine Handlung hinausgeht und den Leser zum Nachdenken über die tieferen Bedeutungen anregt.
Martin Mosebachs Prosa in „Die Richtige“ ist ein Meisterwerk der stilistischen Eigenwilligkeit, die sich bewusst von gängigen Konventionen der Gegenwartsliteratur abhebt. Auffällig ist zunächst die Verwendung der alten Rechtschreibung, die dem Text eine zeitlose, beinahe archaische Qualität verleiht. Dies ist kein bloßer Anachronismus, sondern ein bewusster Kunstgriff, der den Leser von Beginn an in eine andere literarische Welt entführt, eine Welt, in der Sprache nicht nur Mittel zum Zweck ist, sondern selbst zum Gegenstand der Betrachtung wird. Gepaart mit einem ungewöhnlich reichen Wortschatz und einer aufwendigen, oft verschachtelten Syntax, schafft Mosebach eine Sprachlandschaft, die Dichte und Komplexität ausstrahlt.
Ein zentrales Merkmal von Mosebachs Stil ist die „Verlangsamung“ des Leseprozesses. Dies geschieht durch eine Reihe von Techniken, die den Leser dazu zwingen, innezuhalten und die Sprache selbst zu reflektieren. Besonders prägnant sind die eigentümlichen Wortstellungen und die nachgestellten Subjekte. Mosebach verzögert die Nennung des Subjekts oft bis zum Ende des Satzes, was eine Spannung erzeugt und die Aufmerksamkeit auf die Satzkonstruktion lenkt. Ein Beispiel hierfür ist die Beschreibung eines Hornsignals, bei dem nicht das Signal selbst, sondern dessen „schöner runder Klang“ das eigentliche Subjekt bildet. Diese Technik, vom Unklaren zum Klaren zu entwickeln, indem das Subjekt durch Reihungen von Appositionen immer weiter aufgeklärt wird, verleiht der Prosa eine fast meditative Qualität. Das „Undefinierte“ bleibt dabei bezeichnend, was den Leser dazu anregt, über die genaue Bedeutung zu grübeln und sich nicht auf schnelle Interpretationen zu verlassen.
Die Verwendung unspezifischer Referenten wie „die Frau“ oder „der Maler“, selbst nachdem die Figuren bereits namentlich genannt wurden, ist ein weiterer Kunstgriff Mosebachs, der zur Verfremdung beiträgt. Diese „referenzielle Nebelbombe“ schafft eine Distanz zwischen Erzähler und Figuren, die den Leser dazu einlädt, die Charaktere nicht als individuelle Persönlichkeiten, sondern als Chiffren zu betrachten. Sie werden zu Typen, zu allegorischen Figuren, die eine bestimmte Funktion im erzählerischen Gefüge erfüllen. Diese Technik verstärkt den Eindruck, dass die Erzählinstanz die Figuren wie Marionetten führt, sie von einer unbehaglichen Situation zur nächsten bewegt, ohne ihnen eine tiefe psychologische Innenwelt zuzugestehen. Dies mag für manche Leser befremdlich wirken, ist aber ein bewusster Teil von Mosebachs Ästhetik, die sich dem psychologischen Realismus verweigert und stattdessen eine eher klassische, typisierende Darstellung bevorzugt.
Die Dichte der Sprache und die Komplexität der Satzstrukturen erfordern vom Leser eine hohe Konzentration und Bereitschaft, sich auf die Eigenheiten von Mosebachs Stil einzulassen. Es ist keine leichte Lektüre, aber eine, die sich lohnt. Die Sprache selbst wird zum Erlebnis, zum Medium, das die Themen des Romans, Kunst, Wahrnehmung, Realität und Täuschung, auf einer tieferen Ebene widerspiegelt. Mosebachs Prosa ist wie ein fein gewebter Teppich, dessen Muster sich erst bei genauer Betrachtung offenbaren. Die bewusste Verlangsamung und Verfremdung ist dabei kein Selbstzweck, sondern dienen dazu, den Leser aus seiner gewohnten Lesehaltung zu reißen und ihn zu einer aktiveren, reflektierteren Auseinandersetzung mit dem Text zu zwingen. Dies ist ein Merkmal großer Literatur, die nicht nur unterhält, sondern auch herausfordert und bildet.
Martin Mosebachs „Die Richtige“ ist zweifellos ein Roman von hoher literarischer Qualität, der durch seine sprachliche Meisterschaft und seine intellektuelle Tiefe besticht. Doch gerade in seiner Brillanz liegt auch seine größte Provokation und zugleich eine potentielle Schwäche. Mosebachs distanzierte Erzählhaltung und die Reduktion der Charaktere auf Chiffren, die der künstlerischen Vision des Protagonisten Louis Creutz dienen, können beim Leser eine gewisse emotionale Distanz erzeugen. Während diese Distanz stilistisch gewollt ist und die Thematik der künstlerischen Objektivierung unterstreicht, kann sie auch dazu führen, dass die Figuren, insbesondere die weiblichen, als bloße Projektionsflächen für Creutz’ Obsessionen erscheinen. Die Frage nach der Empathie, sowohl der Figuren untereinander als auch der des Lesers gegenüber den Figuren, wird hier auf eine harte Probe gestellt.
Creutz’ künstlerisches Credo, die „Täuschung“ als höchste Form der „Wirklichkeit“ zu betrachten, ist intellektuell faszinierend, aber moralisch ambivalent. Es wirft die Frage auf, inwieweit Kunst das Recht hat, über die menschliche Würde zu triumphieren. Mosebach scheut sich nicht, diese unbequemen Fragen zu stellen, und gerade darin liegt die Stärke des Romans. Er zwingt den Leser, sich mit der dunklen Seite der künstlerischen Schöpfung auseinanderzusetzen, mit der Möglichkeit, dass Genialität mit einer gewissen Kälte und Rücksichtslosigkeit einhergehen kann. Die Darstellung des Kunstbetriebs als „selbstverliebt“ und „zynisch“ ist dabei eine scharfe Kritik, die über die individuelle Künstlerfigur hinausgeht und eine breitere gesellschaftliche Relevanz besitzt.
Die Beziehung zwischen Louis, Dietrich und Astrid ist kein klassisches Liebesdrama, sondern ein psychologisches Experiment, in dem die emotionalen Verwicklungen der Figuren sekundär erscheinen gegenüber Creutz’ künstlerischem Erkenntnisinteresse. Dies kann für Leser, die eine stärkere emotionale Bindung zu den Charakteren suchen, eine Herausforderung darstellen. Mosebachs Fokus liegt nicht auf der Entwicklung von Sympathie, sondern auf der Analyse von Machtdynamiken und der Dekonstruktion romantischer Illusionen. Die „richtige“ Frau ist hier nicht die, die geliebt wird, sondern die, die sich am besten in Creutz’ künstlerisches Konzept einfügt oder es herausfordert.
Ein weiterer Aspekt, der kritisch beleuchtet werden kann, ist die bisweilen hermetische Natur von Mosebachs Prosa. Die verschachtelten Sätze, der reiche Wortschatz und die bewusste Verlangsamung des Leseflusses erfordern ein hohes Maß an Konzentration und literarischer Vorbildung. Dies ist kein Roman für den schnellen Konsum, sondern ein Werk, das eine intensive Auseinandersetzung verlangt. Während dies für Liebhaber anspruchsvoller Literatur ein Genuss ist, könnte es für andere Leser eine Hürde darstellen. Mosebach nimmt hier keine Rücksicht auf die Lesegewohnheiten der breiten Masse, sondern bleibt seinem eigenen ästhetischen Anspruch treu. Dies ist sowohl eine Stärke als auch eine potenzielle Schwäche, da es die Zugänglichkeit des Romans einschränken kann.
Dennoch überwiegen die Stärken des Romans bei Weitem. Mosebachs Fähigkeit, komplexe philosophische und ästhetische Fragen in eine fesselnde Erzählung zu kleiden, ist beeindruckend. Seine präzise Beobachtungsgabe und sein scharfer Intellekt machen „Die Richtige“ zu einem wichtigen Beitrag zur zeitgenössischen deutschen Literatur. Der Roman ist ein Plädoyer für die Kunst als autonome Kraft, die sich nicht den Konventionen des Alltags unterordnet, sondern ihre eigenen Regeln schafft. Er ist eine Herausforderung an den Leser, über die Oberfläche hinauszublicken und die verborgenen Mechanismen von Macht, Manipulation und künstlerischer Schöpfung zu erkennen.
„Die Richtige“ von Martin Mosebach ist ein Roman, der sich dem schnellen Urteil entzieht. Er ist kein leicht zugängliches Werk, sondern fordert den Leser heraus, sich auf seine spezifische Ästhetik und seine intellektuelle Tiefe einzulassen. Mosebach gelingt es, eine Geschichte zu erzählen, die weit über die bloße Handlung hinausgeht und existenzielle Fragen nach der Natur der Kunst, der menschlichen Beziehungen und der Suche nach Wahrheit aufwirft. Die Figur des Louis Creutz ist dabei nicht nur ein Künstler, sondern ein Katalysator, der die verborgenen Seiten der anderen Figuren und der Gesellschaft, in der er sich bewegt, zum Vorschein bringt.
Die bewusste Abkehr von gängigen Erzählkonventionen, die Verwendung einer anspruchsvollen Sprache und die distanzierte Erzählhaltung sind Merkmale, die „Die Richtige“ zu einem herausragenden Werk machen. Sie sind Ausdruck einer literarischen Haltung, die sich dem Mainstream verweigert und stattdessen auf die Kraft der Sprache und die Tiefe der Gedanken setzt. Mosebachs Roman ist somit nicht nur eine kritische Auseinandersetzung mit dem Kunstbetrieb und der menschlichen Psyche, sondern auch ein Statement zur Rolle der Literatur in einer zunehmend schnelllebigen Welt. Er erinnert daran, dass Literatur nicht nur unterhalten, sondern auch provozieren, irritieren und zum Nachdenken anregen kann.
Für Leser, die bereit sind, sich auf dieses literarische Experiment einzulassen, bietet „Die Richtige“ ein reiches und lohnendes Leseerlebnis. Es ist ein Roman, der lange nachklingt und dessen Themen und Figuren immer wieder zur Reflexion anregen. Martin Mosebach hat mit diesem Werk einmal mehr bewiesen, dass er zu den bedeutendsten Stimmen der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur gehört, ein Autor, der es versteht, mit sprachlicher Eleganz und intellektueller Schärfe die Komplexität der menschlichen Existenz auszuloten. „Die Richtige“ ist somit nicht nur ein Roman über Kunst und Liebe, sondern auch ein tiefgründiges Werk über die Suche nach dem, was wirklich zählt, sei es in der Kunst oder im Leben selbst.
Meine Bewertung:
Veröffentlicht am 25. Juni 2025